Die sogenannte „Suche nach dem historischen Jesus“ [auch: „historische Jesusforschung“ oder „Leben-Jesu-Forschung“ genannt] hat sich über mindestens vier Entwicklungsphasen hinweg vollzogen. Dabei ist das Vertrauen in die biblischen Quellen stetig gewachsen. Die verschiedenen Ansätze haben versucht, die Beziehung zwischen der historischen Person Jesus von Nazareth und dem Jesus des Neuen Testaments zu verstehen.
Ein zentraler Aspekt der öffentlichen Diskussion über Jesus ist seine historische Erforschung. Diese entstand aus einer skeptischen Haltung gegenüber der Wahrheit der Bibel, nutzt jedoch allgemein anerkannte historische Methoden zur Überprüfung ihrer Aussagen. Diese Methoden können von einem naturalistischen Ansatz geprägt sein, der übernatürliches Wirken grundsätzlich ausschließt. Wer jedoch offen für Gottes Handeln ist, kann historische Bestätigung als hilfreichen Ansatz sehen, um mit Zweiflern oder Nicht-Gläubigen ins Gespräch zu kommen. Die Geschichte der historischen Jesusforschung ist nicht einheitlich und hat eine Vielzahl von Deutungen über Jesus hervorgebracht, da die Quellen und Methoden unterschiedlich bewertet wurden.
Der Beginn der „Jesus-Quests“
Die Suche nach dem historischen Jesus begann damit, dass einige Kritiker behaupteten, das Jesusbild in der Kirche sei zu sehr von späteren theologischen Entwicklungen überlagert, als dass man Jesu wahre Gestalt erkennen könnte. Skeptische Forscher entwickelten daher Regeln, um das kirchliche Verständnis von Jesus kritisch zu hinterfragen. Diese Regeln basierten auf einer Kombination von Methoden, die Historiker anwendeten, um geschichtliche Ereignisse zu verifizieren und das Quellenmaterial zu hinterfragen. Von Anfang an – bis heute – diente die historische Jesus-Forschung oft dazu, kirchliche Christusbekenntnisse herauszufordern.
Glaubende und Skeptiker sitzen dabei gemeinsam am gleichen Tisch, um darüber zu debattieren, wer Jesus war und woher wir das wissen können. Dabei entstehen naturgemäß hitzige Diskussionen. Die Frage ist: Können Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen über Jesus sprechen, ohne vorauszusetzen, dass man den gesamten kirchlichen Glauben akzeptieren muss? Genau diese Spannung versucht die historische Jesusforschung zu navigieren.
Die „First Quest“ und „Lessings garstiger Graben“
Die erste Suche nach dem historischen Jesus begann bereits im späten 17. Jahrhundert. Verschiedene Gelehrte untersuchten die Unterschiede in den biblischen Texten und stellten infrage, ob die Bibel tatsächlich nur historische Berichte liefert. Sie versuchten dabei, zwischen dem „historischen Jesus“ und dem „Christus des Glaubens“ zu unterscheiden. Viele der frühen Vertreter dieser Forschung hielten den „Christus des Glaubens“ für eine spätere Konstruktion der frühen Kirche und nicht für die wahre Gestalt Jesu.
Diese Debatte war stark von Skepsis gegenüber den biblischen Aussagen über Jesus geprägt. Das Ziel, den „wahren“ Jesus der Geschichte zu rekonstruieren, führte häufig dazu, dass er auf eine moralische Autorität oder einen Propheten unter vielen reduziert wurde. Es wurde zunehmend behauptet, dass eine große Kluft zwischen dem „Christus des Glaubens“ und dem „historischen Jesus“ bestehe. Diese Kluft wurde später als „Lessings garstiger Graben“ bekannt, benannt nach dem deutschen Aufklärungsdenker Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781). Er verwendete das Bild eines Grabens, um die deutliche Trennung zwischen dem biblischen und dem historischen Jesus zu veranschaulichen.
Lessings Ziel war es, ein Bild Jesu zu zeichnen, das frei von späteren theologischen Überlagerungen war. Die Evangelien, so seine Behauptung, zeigten nicht den „echten“ Jesus – vielmehr müsse dieser erst durch kritische historische Untersuchungen aus den Quellen herausgearbeitet werden. Das Argument „Die Bibel sagt es so“ galt in diesem Kontext nicht mehr als ausreichender Beweis. Wer sich allein auf die Schrift berief, lief Gefahr, als naiv oder unwissenschaftlich abgetan zu werden. Lessings Graben machte nicht nur die Unterscheidung zwischen dem „Christus des Glaubens“ und dem „historischen Jesus“ deutlich, sondern erschwerte auch den Dialog zwischen Glaubenden und Skeptikern über die Frage, wer Jesus war und ist.
Einige behaupteten, dass Lessings Graben unüberwindbar sei. Am bekanntesten vertrat diese Ansicht Rudolf Bultmann (1884–1976), der argumentierte, dass wir den historischen Jesus nicht wirklich rekonstruieren könnten (siehe Jesus und das Wort von Bultmann). Für ihn und viele Gleichgesinnte war der „Graben“ eine viel zu harmlose Metapher; es handle sich eher um einen tiefen „Canyon“.
Doch nicht alle waren so radikal skeptisch. Manche versuchten, eine Brücke zwischen dem Christus des Glaubens und dem historischen Jesus zu schlagen. Sie suchten nach Wegen, um Lessings Graben zu überwinden, und argumentierten, dass sorgfältige historische Forschung dabei helfen könne. Skepsis müsse nicht zwangsläufig destruktiv sein – im Gegenteil: Eine kritische Prüfung der Quellen könne zu neuen Fragen und frischen Erkenntnissen führen.
Die Diskussionen begannen bereits im späten 17. Jahrhundert, als Wunderberichte zunehmend hinterfragt wurden, Widersprüche zwischen den Evangelien auffielen und Zweifel an den Aussagen Jesu aufkamen. Damals gab es jedoch noch keine festen Regeln für die historische Beurteilung der biblischen Berichte – vielmehr basierten Entscheidungen auf subjektiven Einschätzungen darüber, was Jesus „wahrscheinlich“ wirklich getan habe. Diese Vielfalt an Jesus-Bildern führte dazu, dass Albert Schweitzer 1906 ein Werk über diese frühe Phase der historischen Jesusforschung veröffentlichte und sie als zu subjektiv und losgelöst vom jüdischen Kontext Jesu kritisierte. Er zeigte, dass die Vielzahl an unterschiedlichen Jesus-Porträts methodische Schwächen aufwies. Seine Analyse fand breite Zustimmung und markierte das Ende der ersten Phase der historischen Jesus-Forschung. In vielerlei Hinsicht war diese erste Periode die skeptischste.
Die „No-Quest“-Periode
Anschließend folgte die sogenannte „No-Quest“-Periode, die sich über die ersten fünf Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts erstreckte. Allerdings ist diese Bezeichnung irreführend, da in dieser Zeit zahlreiche Werke über den historischen Jesus entstanden. Was jedoch fehlte, war eine einheitliche methodische Herangehensweise. Jeder Forscher zeichnete das Bild Jesu, das ihm oder ihr am plausibelsten erschien, ohne eine klare, systematische Methode.
In dieser Phase vertrat Rudolf Bultmann die Auffassung, dass wir über den historischen Jesus so gut wie nichts mit Sicherheit wissen könnten. Sein Einfluss führte dazu, dass diese Zeit als „No-Quest“-Periode bekannt wurde. Viele Gelehrte hielten es für aussichtslos, den historischen Jesus zu rekonstruieren, doch andere widersprachen und arbeiteten weiterhin auf diesem Gebiet.
Die „Second Quest“
1953 änderte sich die vorherrschende Skepsis. Ernst Käsemann, ein Schüler Bultmanns, der mittlerweile selbst Professor war, argumentierte, dass wir mehr über Jesus wissen könnten, als sein berühmter Lehrer behauptet hatte. Er versuchte, spätere griechische Ergänzungen von ursprünglich hebräischen oder aramäischen Traditionen zu trennen. Zudem untersuchte er, wie Überlieferungen weitergegeben und verändert wurden, um Rückschlüsse auf ihren ursprünglichen Kern zu ziehen. Diese Methode ist als Formgeschichte bekannt geworden, die zwischen 1919 und 1921 entstand. Sie besagt, dass mündlich überlieferte Geschichten bestimmten Strukturen (Formen) folgen und meist in kurzen Einheiten weitergegeben wurden. Unterschiede in diesen Formen könnten Hinweise darauf geben, was ursprünglich war und was später hinzugefügt wurde.
Allerdings war die Anwendung der Formgeschichte auf historische Fragen umstritten. Der englische Gelehrte Vincent Taylor schrieb in den 1930er-Jahren, dass sie als literarisches Werkzeug nützlich sei, um den Aufbau einer Geschichte zu analysieren – als historisches Instrument jedoch wertlos sei (und als solches wollten es die Jesusforscher der „Second Quest“ eigentlich nutzen). Dennoch wurden in dieser Zeit erstmals methodische Regeln entwickelt, um der Forschung mehr Struktur zu verleihen und die (berechtigte) Kritik an der Formgeschichte zu entkräften.
Diese methodischen Regeln nannte man „Kriterien der Authentizität“. Zu den wichtigsten gehören:
- Mehrfachbezeugung: Je mehr unabhängige Überlieferungsstränge eine Aussage oder ein Thema enthalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auf Jesus selbst zurückgeht. Dabei zählt nicht nur das Vorkommen in den Evangelien, sondern verschiedene Überlieferungsschichten: das Markusevangelium, die gemeinsame Quelle von Matthäus und Lukas (Q), die jeweiligen Sonderquellen von Matthäus und Lukas, das Johannesevangelium und weitere unabhängige Quellen.
- Dissimilarität (Unähnlichkeit): Eine Überlieferung gilt als besonders glaubwürdig, wenn sie sich weder aus dem jüdischen Kontext Jesu noch aus der frühen christlichen Tradition ableiten lässt. Manche Forscher modifizierten dieses Kriterium dahingehend, dass eine Aussage Jesu nicht völlig unähnlich sein muss, sondern sich in gewisser Weise von beiden abheben sollte.
- Peinlichkeit: Aussagen, die für die frühe Kirche unangenehm oder problematisch gewesen wären, gelten als authentischer, da es unwahrscheinlich ist, dass die Kirche sie erfunden hätte.
- Kohärenz: Aussagen oder Handlungen, die mit Inhalten übereinstimmen, die durch andere Kriterien als authentisch gelten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ebenfalls echt zu sein.
Die Nützlichkeit dieser Kriterien wird weiterhin diskutiert. Manche kritisieren sie als zu selektiv oder subjektiv, während andere sie als notwendige Werkzeuge zur Strukturierung der Forschung sehen. Ein weiteres Problem ist die Frage, wo die Beweislast liegt – ob eine Überlieferung zunächst als echt oder unecht gelten sollte oder ob man neutral an die Untersuchung herangehen muss. Trotz ihrer Unvollkommenheit bleiben diese Kriterien ein wichtiges Instrument zur Bewertung der historischen Quellen über Jesus, da ohne sie die Forschung von rein subjektiven Einschätzungen bestimmt wäre.
Während Ernst Käsemann eine neue Perspektive auf die historische Jesus-Forschung vorschlug, führten bedeutende archäologische Entdeckungen zu einem veränderten Verständnis des religiösen Umfelds im ersten Jahrhundert. Besonders prägend waren die Funde von Qumran, besser bekannt als die Schriftrollen vom Toten Meer, die zwischen 1947 und 1956 entdeckt wurden.
Diese Sammlung von Texten stammte aus einer jüdischen Gemeinschaft, die sich bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. aus dem offiziellen Judentum und dem Tempelkult zurückgezogen hatte. Die Gemeinschaft zog sich in die Wüste zurück und wartete dort auf die göttliche Rechtfertigung ihrer Überzeugungen. Sie bestand fort bis zum Jüdischen Krieg (66–70 n. Chr.), als die Römer das Gebiet eroberten – der Krieg, der zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem führte.
Schriftrollen wurden schließlich in elf verschiedenen Höhlen gefunden. Um die Manuskripte systematisch zu katalogisieren, erhielten sie eine standardisierte Bezeichnung: Ein „Q“ (für Qumran) mit einer Höhlennummer und einer Manuskriptzahl. Beispielsweise steht 4Q174 für das 174. Manuskript aus Höhle 4 von Qumran.
Diese Texte boten völlig neue Einblicke in das Judentum der Zeit Jesu, insbesondere in der Region, in der Johannes der Täufer und Jesus wirkten. Sie stellten auch eine zentrale Annahme der „Second Quest“ infrage – nämlich, dass griechische und jüdische Einflüsse klar voneinander getrennt werden könnten. Tatsächlich zeigte sich, dass selbst eine streng anti-hellenistische jüdische Gruppe Ausdrucksformen verwendete, die zuvor als rein griechisch betrachtet wurden.
Diese Erkenntnisse machten deutlich, dass neue Methoden erforderlich waren, um die Jesus-Überlieferungen zu bewerten.
Die „Third Quest“
Die Veröffentlichung der Schriftrollen vom Toten Meer zeigte, dass das Judentum zur Zeit Jesu wesentlich vielschichtiger war, als zuvor angenommen. Dank dieser Texte und neuer Übersetzungen anderer jüdischer Schriften konnten Forscher das historische und kulturelle Umfeld Jesu genauer untersuchen. Dies führte zur Entstehung einer neuen Forschungsrichtung, die als „Third Quest“ (nach dem historischen Jesus) bekannt wurde.
Diese neue Herangehensweise konzentrierte sich darauf, Jesus im Kontext des Judentums der Zweiten Tempelperiode zu verstehen – jener jüdischen Tradition, in der er aufwuchs und wirkte. Die Vielfalt der jüdischen Strömungen, die sich in den Qumran-Funden und anderen antiken Quellen widerspiegelte, bildete den theologischen Hintergrund für Jesu Lehren und das Denken seiner Zuhörer.
1945 wurden in Nag Hammadi (Ägypten) weitere antike Texte gefunden. Diese enthielten zum Teil spätere Schriften, darunter auch solche, die sich mit Jesus und seiner Bedeutung befassten. Obwohl sie für die „Third Quest“ selbst weniger zentral waren, erregten sie große Aufmerksamkeit und beeinflussten die Debatten über die Vielfalt der frühen Jesusbilder. Zusammen mit den Qumran-Funden trugen sie dazu bei, das Bild Jesu noch komplexer zu machen und neue Perspektiven auf seine historische Bedeutung zu eröffnen.
Die dramatischen neuen Entdeckungen – insbesondere die Schriftrollen vom Toten Meer – trieben die „Third Quest“ nach dem historischen Jesus voran. Diese Forschungsrichtung begann sich in den 1960er Jahren abzuzeichnen, als die Bedeutung der Qumran-Funde zunehmend anerkannt wurde. In den 1980er Jahren verfassten einige Wissenschaftler bereits Arbeiten aus der Perspektive der „Third Quest“ und stellten die Methoden der „Second Quest“ in Frage.
Anders als die Forscher der Zweiten Suche, die sich darauf konzentrierten, die Evangelien kritisch zu analysieren und Schichten herauszulösen, begannen die Vertreter der Dritten Suche mit einer Untersuchung des historischen Kontextes Jesu. Ihr Ziel war es, nicht nur einzelne Überlieferungen auf ihre Authentizität zu prüfen, sondern die Kohärenz des Gesamtbildes Jesu im Licht des Judentums des 1. Jahrhunderts zu betrachten.
Diese Umkehr des Ausgangspunktes griff eine zentrale Überlegung von Albert Schweitzer auf: Wer Jesus verstehen wolle, müsse ihn aus seinem jüdischen Umfeld und der Perspektive seiner damaligen Zuhörer heraus begreifen. Die Gelehrten der „Third Quest“ fragten daher nicht nur, was Jesus sagte und tat, sondern auch, wie seine Worte und Handlungen in seinem historischen Umfeld wahrgenommen wurden und ob sie in dieses Setting logisch hineinpassen.
Die aktuelle Situation der Jesusforschung
Die Suche nach dem historischen Jesus bleibt auch heute noch ein umstrittenes Thema, da es sich um ein komplexes Unterfangen handelt, das darauf abzielt, die Vergangenheit zu rekonstruieren – basierend auf der Auswahl der Quellen und der Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe durch die Forscher. Mit dem Fortschreiten der verschiedenen „Quest“-Perioden hat sich die Tendenz entwickelt, den Quellen mehr zu vertrauen als in den frühen Bemühungen. Vor allem Lessings garstiger Graben soll das, was wirklich nachweisbar ist, zutiefst missverstanden haben.
Sowohl evangelikale als auch nicht-evangelikale Autoren haben sich an diesen Diskussionen beteiligt, insbesondere in den letzten Jahren. Einige Forscher haben betont, dass das Johannesevangelium in diesen Diskussionen mehr Aufmerksamkeit verdienen sollte, als es historisch bisher erhalten hat.
Die Leben-Jesu-Forschung wird weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Debatte über Jesus bleiben, besonders unter Wissenschaftlern, die weiterhin die Zuverlässigkeit der Quellen diskutieren, um dem weit verbreiteten Skeptizismus entgegenzutreten.
Englische Leseempfehlungen:
- N. T. Wright, Jesus and the Victory of God, Vol. 2
- Darrell Bock and Ed Komozewski, eds, Jesus, Skepticism and the Problem of History
- Darrell Bock and Robert Webb, eds., Key Events in the Life of the Historical Jesus
- James Dunn, Jesus Remembered
Hinweis zur Lizenz und Übersetzung:
Dies ist eine Übersetzung des Originalwerks von Darrell L. Bock. Die Veröffentlichung erfolgt unter der freien Lizenz CC BY-SA 4.0. Das bedeutet, dass der Text unter den gleichen Bedingungen weiterverwendet werden darf, sofern die ursprüngliche Quelle genannt und die Lizenz beibehalten wird. Die Veröffentlichung dieser Übersetzung bedeutet jedoch nicht, dass der Autor sie ausdrücklich billigt oder unterstützt.


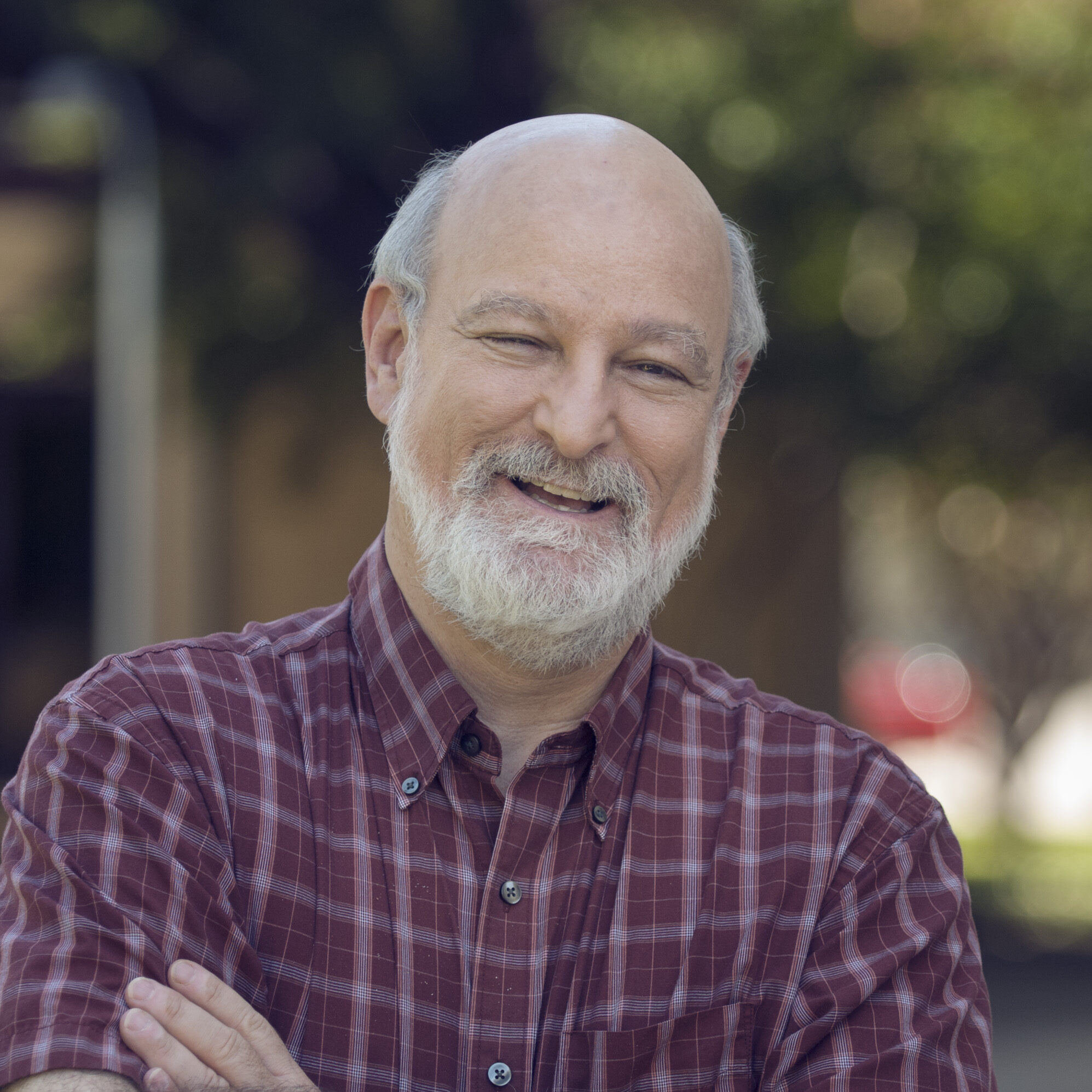
Schreibe einen Kommentar