Wie die Lutherbibel deutsche Sprichwörter prägte
Es haben sich viele deutsche Sprichwörter erhalten, die ursprünglich aus der Lutherbibel stammen. Lange Zeit bis in das Mittelalter hinein lag die Bibel fast nur auf Latein vor, was die allermeisten Menschen nicht lesen konnten. Auch wenn es vor Martin Luther (1483-1546) schon deutsche Bibelübersetzungen gab, war sein Werk ein Novum: Er verband in seiner Übersetzung auf einzigartige Weise die nord- und süddeutschen Dialekte in einer alttagsnahen Sprache, dass sie ein voller Erfolg wurde. Bis heute prägt seine Bibel maßgeblich die deutsche Sprache und schenkte ihr viele erhaltene Sprichwörter. Ob es seine eigenen Formulierungen sind oder er die ihm bekannten Redewendungen in seine Bibel aufnahm, ist an dieser Stelle nicht zu klären. Auf jeden Fall machte er viele Redewendungen populär. Hier findet sich eine Auflistung von 60 deutschen Redewendungen, die generell auf das Alte Testament Bezug nehmen bzw. aus diesem stammen:
60 deutsche Sprichwörter aus der Bibel und ihre Bedeutung
1. „Ein einziges Tohuwabohu“ – Ein großes Durcheinander (1. Mose 1,2)
In der biblischen Schöpfungsgeschichte steht für die ursprüngliche Charakterisierung der Welt der hebräische Ausdruck „Tohu wa bohu“. Luther übersetzte ihn mit „wüst und leer“ ins Deutsche. Dennoch hat sich der hebräische Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten.
2. „Bei Adam und Eva anfangen“ – überflüssig weit ausholen (1. Mose 1f)
Die ersten von Gott geschaffenen Menschen waren laut der Bibel Adam und Eva. Wer also bei einer Erklärung viel zu weit ausschweift, „fängt bei Adam und Eva“ an.
3. „Wie im Paradies“ / „Paradiesische Zustände“ – ideale Zustände (1. Mose 2,8f)
Das Wort „Paradies“ leitet sich von dem persischen Wort für Garten ab. Der Garten Eden, den Gott für die Menschen während seiner Schöpfung anlegte, war perfekt: dort gab es alles, was gut für sie war. Es herrschten also wahrlich „paradiesische Zustände“.
4. „Im Adamskostüm dastehen“ – völlig unbekleidet sein (1. Mose 3,7)
Adam und Eva wurden laut dem biblischen Schöpfungsbericht nackt erschaffen. Erst nach dem Sündenfall erkannten sie dies und schämten sich dafür.
5. „Einen Adamsapfel haben“ – einen auffälligen Kehlkopf haben (1. Mose 3,6)
Adam und Eva wurden von einer Schlange dazu verführt, die Frucht des verbotenen Baumes zu essen – das war das Fanal des Sündenfalls. In Europa wurde diese Frucht zumeist als Apfel identifiziert. Nicht in der Bibel überliefert, aber in der gesellschaftlichen Erzählung weitergegeben wurde die Anekdote, dass Adam während des Naschens der Apfel im Hals stecken blieb.
6. „Im Schweiße meines Angesichts“ – mit großer Anstrengung (1. Mose 3,19)
Nach dem Sündenfall wurden Adam und Eva von Gott bestraft. Über Adam heißt es, dass er von da an „im Schweiße seines Angesichts“ arbeiten werde. Die paradiesischen Zustände waren also vorbei.
7. „Himmelschreiendes Unrecht“ – nicht wiedergutzumachende Ungerechtigkeit (1. Mose 4,10)
Kain, ein Sohn Adams und Evas, tötete seinen Bruder Abel, weil dessen Brandopfer von Gott angenommen worden war, im Gegensatz zu seinem. Nach dem Mord sagte Gott zu Kain: „Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde“.
8. „Ein biblisches Alter erreichen“ – eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer haben (1. Mose 5)
Einige der in der Bibel genannten „Urväter“ des Volkes Israels sollen z.B. laut 1. Mose 5 mehrere Hundert Jahre alt geworden sein, Methusalem gar 969 Jahre (vgl. 1. Mose 5,27). Somit erreichen heute Menschen, die gut über 80 Jahre alt sind, ein in unseren Augen „biblisches Alter“.
9. „Das ist vorsintflutlich!“ – das ist völlig überholt! (1. Mose 7f)
Die große Flut – Sintflut –, die im Alten Testament beschrieben wird, war laut dem biblischen Zeugnis ein historischer Einschnitt relativ am Anfang der Weltgeschichte. Die Zeit davor liegt also schon sehr lange zurück und war völlig andersartig.
10. „Nach uns die Sintflut!“ – Uns ist alles egal! (1. Mose 7f)
Die Wassermassen der Sintflut stiegen laut dem biblischen Bericht höher als alle Berggipfel und zerstörten so den ganzen Planeten mit ihrer Gewalt. Darauf bezog sich die Marquise de Pompadour, die Konkubine des französischen Königs Ludwigs XV. Auf Französisch soll sie 1757 nach einer Niederlage gegen die Preußen gesagt haben: „Après nous le déluge!“. Im Gegensatz zur Gleichgültigkeit, mit der der Spruch heute verwendet wird, soll sie ihn damals aufgrund pessimistischer Vorahnungen getätigt haben.
11. „Sich einen Namen machen“ – prominent sein wollen (1. Mose 11,4)
In der Geschichte vom „Turmbau zu Babel“ wollten sich die Menschen einen großen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, um „sich einen Namen zu machen“. Gott beendete ihr Werk, indem er ihre Sprachen verwirrte, sodass sie sich nicht mehr verständigen konnten und vom Bau des Turms abließen.
12. „Mit Blindheit geschlagen“ – unfähig, das Naheliegende zu erkennen (1. Mose 19,11)
Vor der Zerstörung der Stadt Sodom kommen zwei Boten Gottes in die Stadt, die Lot, der Neffe Abrahams, in sein Haus aufnimmt. Nach dem Essen wird das Haus Lots von einer Gruppe Männer belagert, die die beiden Gäste Lots vergewaltigen wollen. Mit übernatürlicher Macht sorgen die beiden allerdings dafür, dass die feindlich gesinnten Männer blind werden. Anschließend fliehen sie mitsamt Lots Familie aus der Stadt.
13. „Etwas übertreiben“ – die Wahrheit übersteigern (1. Mose 33,13)
Dieses Sprichwort könnte aus einer Erzählung über Jakob stammen. Als er und sein Bruder Esau sich versöhnten, lud Esau ihn ein, mit ihm nach Hause zu ziehen. Der Weg wäre jedoch für die kleinen Kinder und das säugende Vieh, die Jakob begleiteten, zu herausfordernd gewesen. Nach Wochen des Viehtreibens erklärte Jakob seinem Bruder: „[…] wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben“.
14. „Ein Auge auf jemanden werfen“ – jemanden interessant finden (1. Mose 39,7)
Nachdem Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden war, diente er als Angestellter bei Potifar, dem Aufseher der königlichen Leibgarde. Von Potifars Frau heißt es dann, dass sie „ihre Augen auf Josef warf“ und mit ihm schlafen wollte. Auch wenn Josef sich der Situation entziehen konnte, landete er wegen einer Verleumdung von Potifars Frau im Gefängnis.
15. „Wie Sand am Meer“ – in unzähligen Mengen (1. Mose 22,16-18)
Gott schloss mit Abraham, dem Stammvater der Israeliten, einen Bund, in dem er Abraham viele Nachkommen versprach. Diese sollen so zahlreich werden wie der „Sand am Ufer des Meeres“ – also unzählbar.
16. „Ein Land, wo Milch und Honig fließt“ – ein Leben ohne materielle Not (2. Mose 3,8)
Gott erklärt Mose, dass er die versklavten Israeliten aus Ägypten befreien möchte. Er habe das Leid gesehen und möchte sie nun in ein Land herausführen, „darin Milch und Honig fließt“, es also alles im Überfluss gibt.
17. „Sich etwas zu Herzen nehmen“ – sich ernste Gedanken oder Sorgen machen (2. Mose 7,23)
Um die Israeliten aus Ägypten zu befreien, schickte Gott Mose zum Pharao mit dem Auftrag, Gericht zu verkünden. So kommen zehn Plagen über das Land, wobei bei der ersten das Wasser des Nils zu Blut wird. Den Pharao ließ es jedoch kalt, er „nahm es sich nicht zu Herzen“ und behielt die Israeliten weiterhin als Sklaven.
18. „Wie Heuschrecken über etwas herfallen“ – etwas skrupellos ausbeuten (2. Mose 10,13)
Die achte der zehn Plagen, die Gott über Ägypten kommen ließ, war ein gefräßiger Heuschreckenschwarm. Dieser fraß alles, was nicht durch den vorangegangenen Hagel zerstört worden war. Auch nach dieser Plage ließ der Pharao die Israeliten nicht ziehen.
19. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – Gleiches mit Gleichem vergelten (2. Mose 21,24)
Gott gab den Israeliten einen Gesetzeskatalog, der demjenigen, der Unrecht erlitten hatte, eine Wiedergutmachung gewährleistete, die seinem Schaden entsprach. Dass die Aussage „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ nicht wortwörtlich zu verstehen ist, klärt sich z.B. beim Blick auf 2. Mose 21,25: Hier gibt Gott die Anweisung, dass ein Sklave in die Freiheit zu entlassen sei, wenn der Herr ihm mutwillig das Auge zerstört. Das Gleiche gilt für den Zahn eines Sklaven.
20. „Von Angesicht zu Angesicht“ – auf gleicher Augenhöhe (2. Mose 33,10)
Nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten richtete Mose außerhalb ihres Lagers das sogenannte „Zelt der Begegnung“ auf. Von Mose heißt es, dass er mit Gott so persönlich sprechen konnte wie mit einem Freund, eben „von Angesicht zu Angesicht“.
21. „Nicht ganz koscher“ – bedenklich (3. Mose 11)
Das Alte Testament gibt eine Reihe von Speisegeboten vor, in denen aufgelistet ist, welche Tiere die Israeliten essen dürfen und welche nicht. Auch heutige orthodoxe Juden halten sich an diese Vorschriften. „Koscher“ sind dabei alle Tiere, die rein und damit essbar sind.
22. „Zum Sündenbock machen“ – jemandem für alles die Schuld geben (3. Mose 16,8-10)
Gott beauftragt Mose, am „Versöhnungstag“ (Jom Kippur) für die Sünden der Israeliten zwei Ziegenböcke zu nehmen. Der eine von beiden soll stellvertretend für die Sünde der Menschen als Opfer dargebracht werden. Er wird also wortwörtlich zum „Sündenbock“.
23. „In die Wüste schicken“ – eine Beziehung beenden (3. Mose 16,8-10; 16,20-22)
Der andere der beiden Böcke soll symbolisch mit der Schuld der Israeliten beladen und anschließend in die Wüste geschickt werden. Als Zeichen dafür, dass die Vergehen nun endgültig weg sind.
24. „Alle Jubeljahre einmal“ – ziemlich selten (3. Mose 25,10)
Alle 50 Jahre sollte für die Israeliten das sogenannte Jobel-Jahr sein. Der Name leitet sich von dem Hebräischen Wort „Jobel“ ab, was „Widderhorn“ bedeutet. Mit dem Widderhorn wurde das Jobel-Jahr eröffnet, in dem jeder, der unternegativen Bedingungen Besitz oder seine Freiheit verloren hatte, diese wiedererlangen sollte. Für die betroffenen Menschen war es wortwörtlich dann ein „Jubeljahr“, wobei die maximal 50 Jahre des Wartens eine lange Zeit sein konnten.
25. „Jemandem die Leviten lesen“ – energisch zur Ordnung rufen (3. Mose 26)
Der dritte Sohn des Stammvaters Jakob hieß Levi. Seine Nachkommen, die Leviten, waren dem Tempeldienst und damit auch den Einhaltungen der von Gott vorgeschriebenen Regeln verpflichtet. Im 26. Kapitel des 3. Buch Moses, welches auch „Leviticus“ heißt, erklärt Gott den Israeliten, dass sie nach seinen Geboten leben müssen, um Segen zu empfangen; andererseits empfangen sie drastische Strafen. Dieses Kapitel wurde im Mittelalter häufig als Basis für Strafpredigten genutzt, um eben „die Leviten zu lesen“.
26. „Ein Dorn im Auge, ein Stachel im Fleisch sein“ – stören, ärgern (4. Mose 33,55)
Das Sprichwort gibt wieder, wie unangenehm und schmerzend etwas sein kann. Vor der Eroberung Kanaans durch die Israeliten weist Gott sie an, rigoros mit ihren Feinden umzugehen. Falls sie das nicht täten, würden die Bewohner des Landes „zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten“.
27. „Im Dunkeln tappen“ – keine Erklärung finden (5. Mose 28f)
Für den Fall der Abkehr der Israeliten von Gott droht er ihnen furchtbare Gerichte an. Dazu gehört auch die Drohung der Verwirrung des Geistes: „du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln“.
28. „Wie seinen Augapfel hüten“ – besonders gut aufpassen (5. Mose 32,10)
Das Auge ist ein sehr empfindlicher Körperteil, der z.B. vor Sandstürmen oder der heißen Mittagssonne geschützt werden muss. Vor diesem Hintergrund singt Mose davon, wie Gott besonders gut auf Jakob bzw. die Israeliten aufgepasst hat: „Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel.“
29. „Gift und Galle spucken“ – vor Wut unbeherrscht argumentieren (5. Mose 32,32f)
Mose klagte die Abwendung der Israeliten von Gott an und benutzte dafür negative Bilder, um ihren Ungehorsam darzustellen. In Luthers Originaltext von 1545 heißt es, dass die Trauben der Israeliten Galle seien und ihr Wein Gift und ebenso Galle. Letzteres wurde im Mittelalter als gleichbedeutend für bitteren Geschmack verwendet und fand später Eingang in deutsche Sprichwörter.
30. „Jemandem sein Herz ausschütten“ – jemandem seine Sorgen anvertrauen (1. Samuel 1,15)
Hanna litt darunter, unfruchtbar zu sein. Während sie ihr Leid Gott klagte und ihn um ein Kind bat, hörte ihr der Hohepriester zu und verdächtigte sie, betrunken zu sein. Diese Anschuldigung wies sie von sich und antwortete, dass sie ihr „Herz vor dem Herrn ausgeschüttet“ habe. Gott sollte sie schließlich erhören und ihr einen Sohn schenken: den Propheten Samuel.
31. „Was das Herz begehrt“ – was man sich (insgeheim) wünscht (1. Samuel 2,16)
Hofni und Pinhas, die beiden Söhne des Hohepriesters Eli, dienten im israelischen Heiligtum in Silo. Vielmehr muss man sagen: sie bedienten sich. Die beiden werden als „ruchlose Männer“ bezeichnet, die sich am Fleisch im Heiligtum gütlich taten, welches eigentlich für die Opferung verwendet werden sollte. Vor einer Opferung forderte einer den opfernden Mann auf, ihm Fleisch für eine Mahlzeit zu geben. Dieser antwortete, dass doch erstmal das Fett des Tieres als Rauch aufsteigen soll und der Priesterdiener es sich danach nehmen solle, „ganz wie es deine Seele begehrt“.
32. „Sich Asche aufs Haupt streuen“ – Trauer bezeugen, sich demütigen, etwas bereuen (2. Samuel 13,19)
Amnon, einer der Söhne König Davids, vergewaltigte seine Halbschwester Tamar. Diese ungeheuerliche Demütigung drückte Tamar aus, indem sie sich „Asche auf ihr Haupt“ streute und ihr Kleid zerriss. An anderen Stellen wird die Asche in Verbindung mit Menschen erwähnt, die ihre Fehler bereuen und für diese Buße tun (Jona 3,6; Matthäus 11,21).
33. „Über den Jordan gehen“ – sterben (4. Mose 33,51)
Die Bedeutung des Sprichwortes lässt sich nicht direkt mit einer biblischen Passage herleiten, in der jemand nach der Übertretung des Flusses Jordan stirbt. Vielmehr stellt der Fluss auf verschiedene Weisen eine Art Grenze zwischen Leben und Tod dar. Der Jordan stellte für die Israeliten die letzte natürliche Grenze zum versprochenen Land dar, die es zu überschreiten galt. Josef lässt seinen verstorbenen Vater Jakob zur Bestattung über den Jordan nach Kanaan bringen (1. Mose 50,11-13) während der Prophet Elia nach Überquerung des Jordan in den Himmel entrückt wird (2. Könige 2,11). Das gelobte Land Kanaan stellt auch einen Sehnsuchtsort der Israeliten dar, genauso wie es der Himmel im christlichen Glauben tut.
34. „Etwas wächst einem über den Kopf“ – überfordert sein (Esra 9,6)
Der jüdische Priester Esra beklagte, nachdem er aus der Gefangenschaft in Babylon nach Israel zurückkehren durfte, die familiäre Vermischung der Israeliten mit ihren Nachbarvölkern. Diese Vermischung hatte eine Übernahme heidnischer Bräuche zur Folge. Esra drückte sein Entsetzen durch das Zerreißen seiner Kleidung aus und bekannte Gott: „Unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel“. Hier meint das Sprichwort also eine Schuld, die zu groß wird. Analog dazu gebraucht man es heute, wenn man generell von etwas überfordert ist.
35. „Eine Hiobsbotschaft bekommen“ – Nachricht von einem Unglück erhalten (Hiob 1,14-19)
Zu Anfang des Buches Hiob erlaubt Gott dem Satan, den reichen und frommen Hiob heimzusuchen. So wird der gesamte Viehbestand von Hiob vernichtet und alle seine zehn Kinder sterben. Die Nachrichten davon werden ihm von vier unterschiedlichen Boten übermittelt – Hiobsbotschaften eben.
36. „Die Haare stehen zu Berge“ – es ist schrecklich/gruselig (Hiob 4,15)
Elifas, einer der Freunde Hiobs, die ihn während seiner Leidenszeit besuchten, hatte eine nächtliche Offenbarung. In dieser sei ihm durch eine Gestalt mitgeteilt worden, dass kein Mensch gerecht vor Gott sein kann. Diese Begegnung war für ihn so unheimlich, dass ihm „die Haare zu Berge“ standen.
37. „(Nicht) von gestern sein“ – (keine) überholten Ansichten haben (Hiob 8,9)
Wenn jemand „von gestern“ ist, hat er veraltete Meinungen oder Lebensweisen. Der Ausspruch, auf den das Sprichwort zurückgeht, hält hingegen denjenigen, der von gestern ist, noch für unerfahren. Bildad, ein anderer Freund Hiobs, rät dem Geplagten nämlich: „Frage die früheren Geschlechter und merke auf das, was ihre Väter erforscht haben, denn wir sind von gestern her und wissen nichts“.
38. „Jugendsünden“ – längst vergangene Missetaten (Hiob 13,23-26)
Jugendsünden sind in unserer Umgangssprache Verfehlungen eines Menschen, die er früher im Überschwang getan hat und keine Vergeltung mehr verlangen. In seinem Leid drückt Hiob aus, dass er sich so fühlt, als ob Gott ihn auch wegen lang zurückliegender Sünden bestrafen würde („Sünde meiner Jugend“).
39. „Auf keinen grünen Zweig kommen“ – erfolglos sein (Hiob 15,32)
Elifas, ein Freund Hiobs, teilt gegen den Geplagten aus, dass er schuldig vor Gott geworden sei und kritisiert ihn, dass er sich Gottes Trost nicht zu Herzen nimmt. Dann kommt er auf die Menschen zu sprechen, die sich gegen Gott wenden und so ihr eigenes Unglück heraufbeschwören. Die Folge sei, dass ihr „Zweig nicht mehr grünen“ wird. Im Mittelalter überreichte man auch bei der Übergabe eines Grundstücks an seinen neuen Besitzer einen grünen Zweig.
40. „Mit etwas schwanger gehen“ – etwas vorhaben (Hiob 15,35)
Elifas führt weiter aus, dass die Menschen ohne Gott schwanger seien mit „Mühsal“ und „Unglück“ gebären würden. Hier verwendete Luther in seiner Bibelübersetzung also den positiven Begriff der Schwangerschaft in einem negativen Kontext. Erhalten hat sich diese Formulierung in deutschen Sprichwörtern mit der Bedeutung, dass in Menschen, die mit etwas schwanger gehen, die Überzeugung reift, ein bestimmtes Vorhaben umzusetzen.
41. „Auf Herz und Nieren prüfen“ – etwas sehr gründlich untersuchen (Psalm 7,10)
Nieren und Herz galten im Mittelalter als Zentrum des Menschen bzw. als sein Innerstes. Der Beter des siebten Psalms bezeichnet Gott als jemanden, der „Herzen und Nieren“ prüft, also ganz genau schaut, wie die innere Einstellung eines jeden ist. Heutzutage werden selbst tote Dinge wie Autos auf Herz und Nieren geprüft.
42. „Etwas in sich hineinfressen“ – Gefühle unterdrücken (Psalm 39,3)
In diesem Psalm von David geht es um die menschliche Vergänglichkeit. Zu Anfang erklärt er, dass er sich nicht mehr mit Worten versündigen möchte und daher verstumme und sein Leid in sich hinein fresse. In einem späteren Vers bittet David dann Gott schließlich, ihn in Anbetracht seiner Vergänglichkeit von seinen Sünden zu erretten.
43. „Mit Füßen treten“ – verachten (Psalm 41,10)
David drückt in diesem Psalm seine Verzweiflung darüber aus, dass sowohl seine Feinde als auch einer seiner (ehemaligen) Freunde ihn verachten und ihm Böses wollen. Dieser „Freund“ würde ihn „mit Füßen treten“. In dieser schlimmen Situation wendet sich David an Gott und bittet ihn um Hilfe.
44. „Jemanden auf Händen tragen“ – Jemandem viel Zuneigung und Fürsorge entgegenbringen (Psalm 91,11)
In diesem Vers steht, dass Gott seinen Engeln befohlen habe, „dich“ zu „behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ Die Person hat also den ganzen himmlischen Beistand bei sich, den man sich vorstellen kann. Wenn nun jemand „auf Händen getragen wird“, empfängt er eine starke Zuneigung und Fürsorge – wenn auch weniger perfekt als im zitierten Psalm 91.
45. „Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf“ – Gottvertrauen zahlt sich aus (Psalm 127,2)
Man sollte sich laut dieser Redewendung nicht zu viele Sorgen machen und stattdessen auf Gott vertrauen, da er die Dinge gut machen wird. So erklärt der Psalm 127, dass es ohne Gottes Hilfe nichts nütze, etwas zu tun. Vielmehr ist er derjenige, der Gelingen schenkt, und das auf unspektakuläre Art und Weise: „denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf“.
46. „Das ist ein zweischneidiges Schwert“ – eine Sache hat Vor-, aber auch Nachteile (Sprüche 5,4)
König Salomo warnt seinen Sohn vor einer Frau, die ihn zum Ehebruch verführen möchte, da diese ihn dadurch ins lebenslange Verderben führen würde. Eine solche Frau sei „bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert“. Heutzutage gebraucht man diese Redewendung, um klarzustellen, dass etwas Vor-, aber auch Nachteile hat. In diesem Vers ist allerdings klar, dass das „zweischneidige Schwert“ nur schlecht ist.
47. „Ein Nimmersatt sein“ –nicht genug bekommen können (Prediger 1,8)
Man könnte Salomo, den Autor des Predigerbuches, als Kulturpessimisten bezeichnen. Er erklärt, dass alles, was der Mensch tut, letztlich nichtig ist und keinen Gewinn einbringt. Auch das Sammeln von Eindrücken ist letztlich nichtig: „Das Auge sieht sich niemals satt, und das Ohr hört sich niemals satt“. Daraus könnte sich die Formulierung des „Nimmersatt“ gebildet haben, die etwas verächtlich zum Ausdruck bringt, dass jemand nicht genug von etwas bekommen kann.
48. „Nichts Neues unter der Sonne“ – alles schon mal da gewesen (Prediger 1,9)
Neben den Sinneseindrücken ist für Salomo fast alles nichtig, was der Mensch tun kann, da dieser irgendwann einmal sterben muss. Und egal wie scheinbar erfolgreich oder auch nicht erfolgreich jemand war, hat dies letztlich auch keinen bleibenden Wert, denn „es geschieht nichts Neues unter der Sonne“.
49. „Alles zu seiner Zeit“ – in der richtigen Reihenfolge (Prediger 3,1)
Diese Redewendung drückt aus, dass man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen sollte, dass es also für eine Sache einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt geben kann. Genau das formuliert Salomo: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit […]“. All das steht im Kontrast dazu, was Gott tut, denn das ist ewig.
50. „Im Elfenbeinturm leben“ – weltfremd sein (Hohelied 7,5)
Das Hohelied ist ein Dialog zwischen Salomo und seiner Geliebten Sulamith, die sich ihre Zuneigung in romantischen und erotischen Passagen zusprechen. Salomo schwärmt von seiner großen Liebe: „Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Deine Augen sind wie Teiche von Heschbon am Tor Bat-Rabbim. […] Wie schön und lieblich bist du, du Lieber voller Wonne!“ Die ursprüngliche ästhetische Bedeutung des Elfenbeinturms ist nicht erhalten geblieben. Vielmehr sagt man heutzutage, dass lebensferne Künstler, Gelehrte oder Politiker in einem Elfenbeinturm leben.
51. „Nur ein Lippenbekenntnis ablegen“ – unzuverlässig sein (Jesaja 29,13)
Jemand, der ein Lippenbekenntnis ablegt, ist in Wahrheit gar nicht von dem überzeugt, was er sagt. So klagt der Prophet Jesaja über die Israeliten und droht ihnen ein Gericht Gottes an, indem er Gott zitiert: „Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist […], darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen […].“
52. „Den Kopf hängen lassen“ – traurig oder mutlos sein (Jesaja 58,5)
Gott kritisiert die Israeliten für ihre Doppelmoral: obwohl sie fromme Übungen wie Fasten vollziehen, gehen sie weiterhin ihren eigenen Geschäften nach, ohne auf Gott zu hören. Er gebraucht das Bild der Blüte eines Schilfrohrs, welche leicht herabhängt, um seiner Kritik Ausdruck zu verleihen: „Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit (selbst verletzt), wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet?“.
53. „Einen Lockvogel benutzen“ – einen Köder auslegen (Jeremia 5,26f)
Im Mittelalter war es übliche Praxis, einen Vogel in der Nähe einer mit Pech oder Leim bestrichenen zu platzieren, um dessen Artgenossen anzulocken, die dann in die Falle tappten. Dieser Vergleich mit einem „Lockvogel“ findet sich im Buch des Propheten Jeremia, in dem Gott die Israeliten für ihre Bosheit anklagt: „Man findet unter meinem Volk Gottlose, die den Leuten nachstellen und Fallen zurichten, um sie zu fangen, wie’s die Vogelfänger tun. Ihre Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ist.“
54. „Brief und Siegel geben“ – Gewissheit vermitteln (Jeremia 32,44)
Ursprünglich meinte das Wort „Brief“ eine amtliche Urkunde bzw. einen Erlass, der durch die Unterschrift und das Siegel des Landesherrn erst Gültigkeit beanspruchen durfte. Luther hat dies im Hinterkopf, wenn er übersetzt: „Man wird Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und Zeugen dazu nehmen im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas“.
55. „Ein Koloss auf tönernen Füßen“ – beeindruckend, aber wehrlos sein (Daniel 2,31ff)
Der babylonische König Nebukadnezar träumte von einer gewaltigen Statue, deren Bestandteile von oben nach unten immer wertloser werden. So ist der Kopf aus Gold, während die Brust nur noch aus Silber, der Bauch aus Kupfer und die Schenkel aus Eisen bestehen. Die Füße bestehen teilweise aus Eisen und teilweise aus Ton. Der junge Jude Daniel deutet den königlichen Traum so, dass sein Reich nach und nach von anderen Reichen abgelöst werden wird, also trotz seinem aktuellen Glanz nicht Bestand haben wird.
56. „Das ist ein Menetekel“ – das ist ein unheilvolles Vorzeichen (Daniel 5,25)
Der babylonische König Belsazar verwendete bei einem Festgelage die Gefäße aus dem jüdischen Tempel, entweihte sie also aus jüdischer Sicht. Währenddessen erschien eine Hand, die eine geheimnisvolle Schrift an die Wand malte. Nur Daniel konnte diese mit Gottes Hilfe entziffern: „Mene, mene, tekel uparsin“. Ihre Bedeutung war, dass Gott Belsazar metaphorisch als zu leicht empfunden hat und über ihn Gericht üben würde. In derselben Nacht wurde der König ermordet.
57. „Schwerter zu Pflugscharen machen“ – abrüsten (Micha 4,3)
Dieses Sprichwort geht unter anderem auf eine Friedensmission des Propheten Micha zurück: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen“. Populär wurde dieser Vers in der Friedensbewegung der 1980er Jahre, die sich für eine nukleare Abrüstung der Supermächte USA und Sowjetunion einsetzte.
58. „Himmel und Erde in Bewegung setzen“ – alles tun, um ein Ziel zu erreichen (Haggai 2,6)
Luthers Übersetzung eines Ausspruchs Gottes im Buch Haggai lautet in modernerer Fassung: „Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern“. In seiner ursprünglichen Fassung ist von „bewegen“ die Rede. In diesem Vers bezieht sich der Vers also darauf, was Gott tut, heutzutage verwenden wir diese deutsche Redewendung, wenn wir ausdrücken wollen, dass jemand alles daran setzt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
59. „Nicht mehr wissen, wo rechts und links ist“ – orientierungslos sein (Jona 4,11)
Der Prophet Jona wurde von Gott beauftragt, der assyrischen Stadt Ninive ihre Vernichtung zu verkünden. Nachdem Jona dies gemacht hatte und die Einwohner zu Gott umgekehrt waren, verschonte Gott die Stadt, was Jona sehr ärgerte. Daraufhin antwortete Gott Jona Folgendes: „Mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hunderundzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?“ In Luthers Originaltext von 1545 steht „recht oder linck“ im Sinne von „richtig oder falsch“.
60. „Einen Denkzettel verpassen“ – etwas nachdrücklich in Erinnerung rufen (Maleachi 3,16)
Der „Denkzettel“ war ursprünglich eine Mahnschrift in einem Rechtsgeschäft. Der Prophet Maleachi spricht von einem „Gedenkbuch“, was vor Gott über all diejenigen geschrieben wurde, die Gott fürchten. So bleibt Gott also über diejenigen informiert, die ihm nachfolgen wollen. In Luthers Original steht an dieser Stelle der „Denkzettel“.
Literatur
Wagner, Gerhard: Wer’s glaubt wird selig! Redewendungen aus der Bibel, Rheinbach 2017.

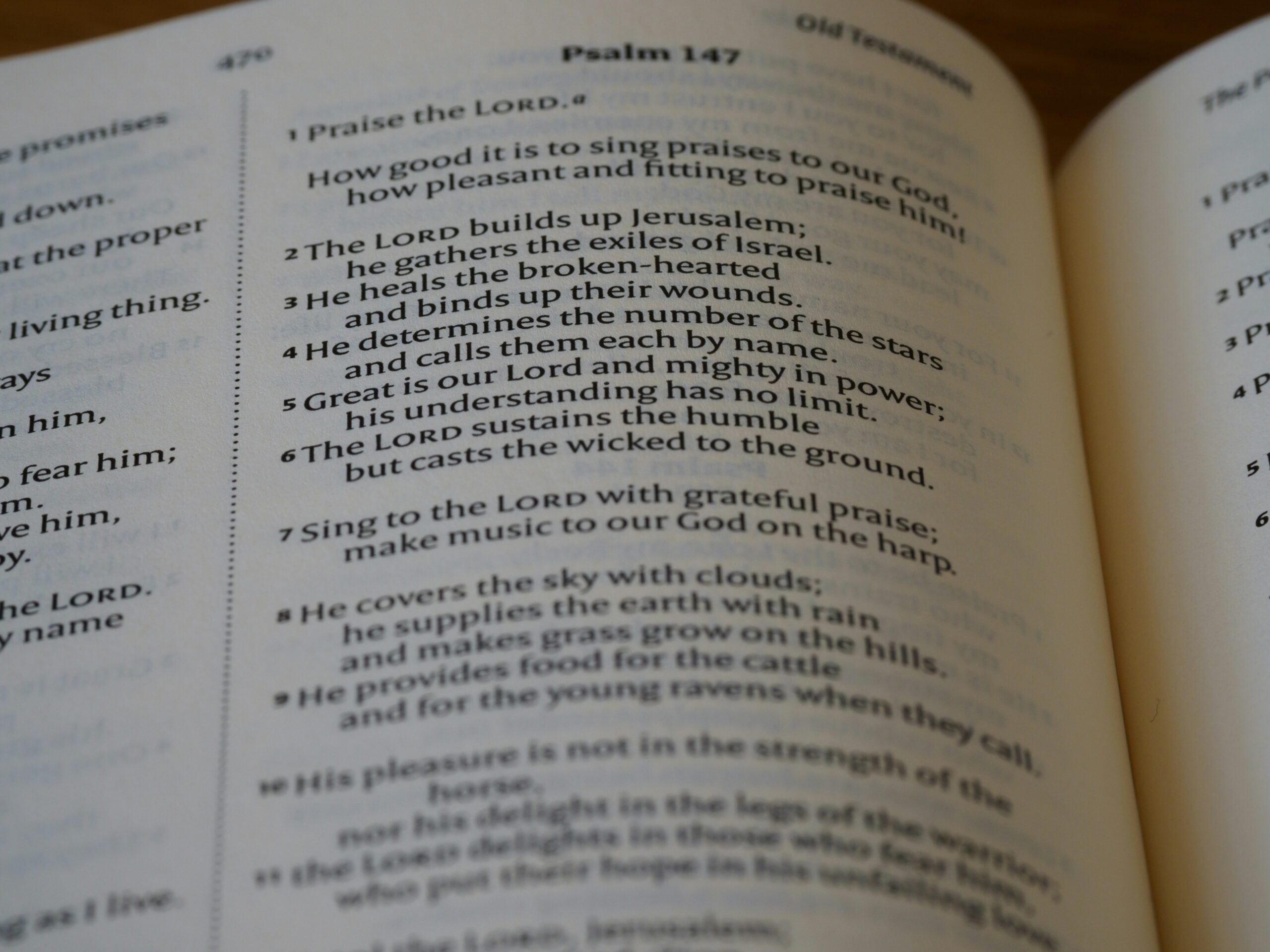

Schreibe einen Kommentar