Dieser Artikel ist der Dritte Teil einer Artikelreihe über die Messianität Jesu. Erschienen ist bisher:
In einem feierlichen Moment fragt Jesus seine Jünger, für wen ihn die Leute halten (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21). Während verschiedene Deutungen vorgeschlagen werden, fragt Jesus auch das Verständnis seiner eigenen Jünger ab. Das ist der Moment, in dem Petrus sein Bekenntnis ablegt, das von Jesus als göttliche Offenbarung bestätigt, wird: „Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn“ (Mt 16,16).
Dieses Bekenntnis von Petrus zeigt uns, dass die Autoren des Neuen Testaments auf bereits vorhandene Konzepte und Erwartungen an den Christus, den Messias, den Gesalbten zurückgreifen . Gelegentlich werden diese vorhandenen volkstümlichen Konzepte der Messias-Erwartung durch Jesus korrigiert und/oder erweitert. Ein Beispiel für eine solche Korrektur ist Jesu Streitgespräch mit den Pharisäern über die Beziehung des Messias zu David, die in Ps 110,1 aufgegriffen wird. Jesus konfrontiert die Pharisäer mit der Frage, wie Christus der Sohn Davids sein könne, wenn David ihn doch als (seinen) Herrn bezeichnet (Mt 22,41-46) und konfrontiert seine Zuhörer auf eine für alle überraschende Weise mit ihren Erwartungen an den Messias.
Ein Beispiel für die unerwartete Erweiterung der messianischen Erwartung ist sicherlich, dass auch „Heiden die Umkehr gegeben“ wurde, „die zum Leben führt“ (Apg 11,18). Dass Heiden, ohne dass sie jüdische Proselyten und formell jüdisch werden, bereits teilhaftig des Heiligen Geistes sind, berichtet uns die Apostelgeschichte erst in Kapitel 10 und 11, was wenige Jahre nach dem Pfingstereignis von Kapitel 2 stattfand! Dabei musste nicht die Prophetie der Schrift erweitert werden, sondern die Erwartungen der Jünger. Einige Zeit später muss Jakobus zugeben, der traditionell als eher konservativer Vertreter der ersten Kirchenleiter verstanden wird, dass gerade durch dieses Teilhaftigwerden der Heiden die Wiederherstellung der „zerfallenen Hütte Davids“ stattfindet, die einst von Amos verheißen wurde (Apg 15,13-18, die auf Am 9,11-12 Bezug nimmt). Die Beziehung von Gottes Sohn und Gottes Volk musste eine Transformation durchlaufen. Kein Wunder: Mit Jesus ist ein neuer Bund, ein neues Zeitalter angebrochen.
Nicht immer entsprechen die Christus-Erwartungen des jüdischen Volkes der vorgefundenen Realität oder den Darstellungen des Alten Testaments. Als Jesus auf dem Laubhüttenfest erscheint, entsteht im Volk eine Diskussion darüber, „ob unsere Oberen wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist?“ (Joh 7,26). Johannes berichtet dann von einem Argument, dass gegen die Messianität Jesu vorgebracht wird: „Doch wir wissen, woher dieser ist; wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist.“ (Joh 7,27)[1]. Hier hat das Volk ein anderes Verständnis, als die Schriftgelehrten, die Micha 5,1 im Blick hatten, um einen konkreten Geburtsort für den Messias angeben zu können.
Obwohl das Neue Testament ununterbrochen Jesus als den Christus, der im Tanach verheißen wurde, hervorhebt, werden damit nicht alle im Volk verbreiteten Christus-Erwartungen bestätigt. Ein gewichtiges Beispiel für enttäuschte Messias-Erwartungen finden wir in der Frage Johannes des Täufers, die uns in Mt 11,1-3 (vgl. auch den Paralleltext in Lk 7,18-23) begegnet. Johannes konnte Erwartung und Erfüllung nicht zufriedenstellend zusammenbringen:
„Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, ging er von dort weiter, zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?“
Das ausgerechnet Johannes Zweifel an Jesu Messanität anmeldet, klingt zunächst überraschend. Johannes ist es, der bereits im Mutterleib Jesus erkennt (Luk 1,41) und im Johannes Evangelium von der ersten Begegnung an sich zu Jesus bekennt (Joh 1,19-27. Als sich im Volk Gerüchte verbreiten, dass womöglich Johannes selbst der Messias sei, weißt er alle messianischen Würden entschieden von sich ab (Joh 1,19-27). Sein Dienst ist zu niedrig, um mit dem des Messias vergliechen zu werden. Er wäre noch nicht einmal würdig, die Riemen seiner Sandalen zu lösen (Joh 1,27): „Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich.“ (V. 30). Johannes spricht sogar von einem Zeichen, das für ihn vorgesehen war, damit er das „Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt wegnimmt“ (V. 29) erkennen kann. Das Johannes-Evangelium berichtet uns, dass Johannes schon im Voraus wusste, woran er den Sohn Gottes erkennen soll: „Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft“ (V. 33). Johannes ist so überzeugt vom Erlebten, dass er seine Jünger ermutigt, ihn zu verlassen und Jesus nachzufolgen (V. 35- 42). Als sich die Jünger des Johannes um die sinkende Bedeutung ihres Meisters Sorgen machen können, hält Johannes das bekannte Zeugnis: „Er muss wachsen, ich aber abnehmen“ (Joh 3,30).
Was ist es also, das Johannes in Zweifel stürzt? Die manchmal vorgebrachte psychologische Deutung, dass es die Haftbedingungen und die Einsamkeit der Zelle waren, ist nicht überzeugend, wenn man sich das Leben des Täufers vor Augen führt. Er war sowohl einen einsamen wie auch einen asketischen Lebensstil gewohnt. Wohnort: Wüste, ein Kleidungsstück, zu Essen nur das, was die Wüste hergibt. Selbst Jesus nimmt auf diesen Lebensstil Bezug (Mt 11,18f., Lk 7,33f.) als er diesen mit seinem eigenen kontrastiert! Es ist somit kaum davon auszugehen, dass die Haftbedingungen diesen Mann brechen sollten. Nicht persönliche Erfahrungen waren der Grund für seine Zweifel, sondern unerfüllte Messias-Erwartungen. Näher an die Ursache der Zweifel des Täufers kommen wir, wenn wir die Predigten des Täufers näher anschauen. Johannes ist ein Prediger der Buße. Seine Taufe war eine Taufe der Buße (Mt 3,11; Mk 1,4; Lk 3,3; Apg 13,24, Apg 19,4[2]), die er als Vorbereitung zum Kommen des Messias versteht (Mt 3,3; Jes 40,3; 57,14). Dabei fällt die Erwartung des Gerichts, das mit dem Erscheinen des Messias kommen soll, besonders auf: „Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen“ (Mt 3,12) ist dabei auf den bezogen, der „nach mir kommt […] er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen“ (Mt 3,11)[3]. Wenn Johannes von einer würdigen Art von Buße spricht (V. 8), dann weil er weiß, dass „die Axt an die Wurzel der Bäume“ (V. 10) gelegt ist.
Jesus beginnt noch zu den Wirkzeigen von Johannes mit seinem Dienst in Galiläa. Doch jede Art von Gericht bleibt aus. Man beachte den Kontext, in dem die Frage des Johannes eingebettet ist: „Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte […]“(Mt 11,2). Gerade als Johannes die Werke Jesu betrachtet, vermisst er etwas. Er vermisst die Trennung von Weizen und Spreu (Mt 3,12), keine Axt an den Wurzeln der Bäume (Mt 3,10)! Die Frage des Täufers ist weniger eine Geringschätzung der Werke Jesu, als eine Irritation darüber, dass ein wichtiges messianisches Element, nämlich das Gericht fehlt.
Das Thema „Gericht“ beeinflusst es jeden Aspekt biblischer Theologie:[4] Gott (Mal 2,17), das Individuum (Mi 6,8), die Gesellschaft (Am 5,15). Während das Alte Testament das Gericht innerhalb der Geschichte betont, betont das Neue Testament das Eschatologische Gericht. Alec Motyer führt aus:
„In der alttestamentlichen Zeit wurde jeder neue König als möglicher messianischer König, jeder neue Prophet als möglicher Prophet wie Mose und jede neue historische Prüfung als möglicher ‚Tag des Herrn‘ erwartet (Jes 13,6.9; Jer 46,10; Hes 30,2-3; Joel 1,15; 2,1.11.31; 3,14; Amos 5,18; Obd 15; Zef 1,14-16; Sach 14:1). Im NT wird daraus der letzte Tag, der Tag Christi, der große Tag Gottes des Allmächtigen (Joh 6,39; Röm 2,5; 1Kor 1,8; 5,5; Eph 4,30; 2Thess 1,10; 1Petr 2,12; 2Petr 3,12; Offb 6,17; 16,14). Beide Testamente verweisen auf die Endgültigkeit, die gerechte Vergeltung und die freudige Erlösung an jenem Tag sowie auf die Errichtung eines neuen Himmels und einer neuen Erde.“ [5]
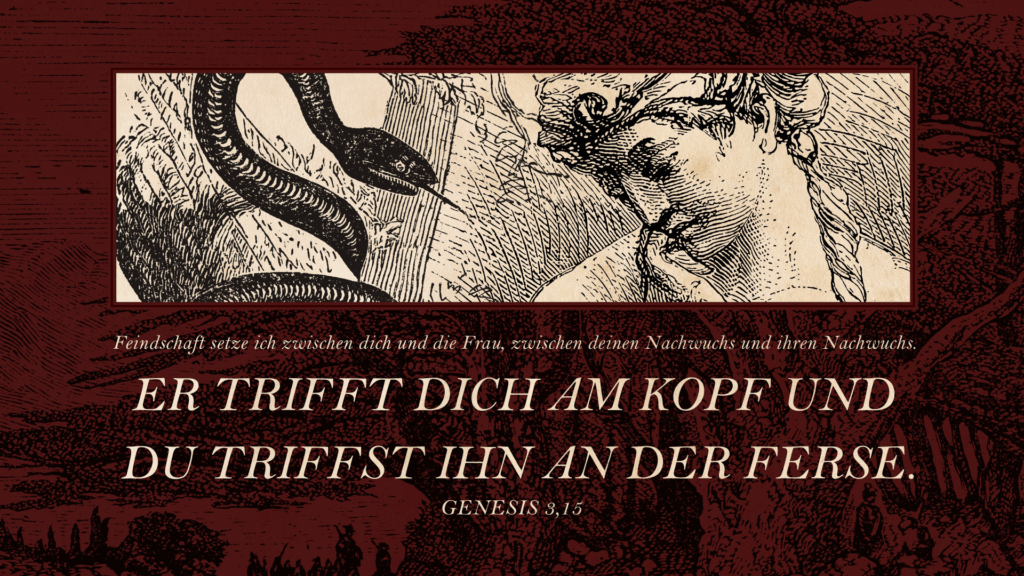
Die Verknüpfung von Gericht und Gerechtigkeit mit der messianischen Erwartung findet sich bereits bei der allerersten messianischen Verheißung überhaupt. „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.“ (1Mose 3,15). Die Erwartung des Schlangenbezwingers, der das Böse beendet, in dem er der Schlange den Kopf zertrümmert ist ein sich wiederholendes Motiv der Bibel. Es begegnet uns in der Frau von Tebez die einen Mühlstein auf Abimelechs Kopf wirft und diesen zertrümmert (Ri 9,49), als Jael mit einem Zeltpflock Siseras Schläfe zertrümmert (Ri 4,21). Ein Schlangenbezwinger ist auch Josua. Als sie die fünf kanaanäischen Könige fangen, stellen seine Anführer zunächst ihre Füße auf ihre Nacken (Jos 10,24-26), bevor sie erschlagen werden. Auf diese Weise erwartet auch der Täufer den ultimativen Schlangenbezwinger, als er unbußfertige Taufkandidaten aus den Reihen der Pharisäer und Sadduzäer antrifft: „Otternbrut!“. An das Kommen des Messias ist von Anfang eine große Erwartungshaltung verknüpft: Er wird der Schlange, dem Satan, sowie auch seiner Brut ein Ende bereiten. Er wird Gerechtigkeit aufrichten. Ein Psalm drückt es so aus: „Gott, dein Thron bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel; darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deiner Gefährten.“ (Ps 45,7-8). Dieser Text wird zu einer Perle im Kettenzitat des ersten Kapitels des Hebräerbriefs, in dem der Autor die Gottheit und Überlegenheit Christi verteidigt. Messianität und Gerechtigkeit sind nicht nur an dieser Stelle untrennbar verknüpft, sondern auch in Jer 23,5-6, das einen König aus den Nachkommen Davids kommen sind, der „Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird“. Ähnlich spricht Jes 24,21-23 von einem König, der alle anderen Könige richten wird. Die drei Stellen sind eine Auswahl an Texten, die eine gerechte Herrschaft unter dem Messias ankündigen.
Nach dieser Vollendung der Gerechtigkeit Gottes sehnt sich Johannes. Doch ist es überhaupt angemessen angesichts der Gnadenbotschaft die vom Messias ausgeht, überhaupt noch von Gottes Zorn, seiner Gerechtigkeit und seinem Gericht zu sprechen?. Hat vielleicht A.T. Hansons recht, den John Stott in „Das Kreuz“ zitiert:
„Wenn man sich den Zorn als eine Haltung Gottes denkt, kommt man um eine Theorie der Sühnung nicht herum. Doch im Neuen Testament ist nie davon die Rede, dass der Zorn versühnt würde; denn er wird nicht als eine Haltung Gottes aufgefasst“[6].
Stott zeigt im weiteren Verlauf des Buches auf, wie das Sühne-Verständnis im Kreuzestod Jesu dadurch lächerlich gemacht wird, indem man es bewusst primitiv konstruiert und mit Animismus gleichsetzt. Stott schreibt:
„Der Grund, warum eine Sühnung notwendig ist, besteht darin, dass Sünde den Zorn Gottes erregt. Das bedeutet nicht (wie Animisten fürchten), dass damit zu rechnen wäre, dass ihm bei der geringfügigsten Provokation der Kragen platzt, geschweige denn, dass er aus gar keinem ersichtlichen Grund die Beherrschung verliert. Denn es ist nichts Launenhaftes oder Willkürliches an dem heiligen Gott. Ebenso wenig ist er jemals reizbar, boshaft, gehässig oder rachsüchtig. Sein Zorn ist weder rätselhaft noch irrational. Er ist nie unberechenbar, sondern immer berechenbar, denn er wird durch das Böse und nur durch das Böse allein provoziert“.[7]
Nach Golgatha dürfte es uns leichter fallen, das zu verstehen und zu sehen, was Johannes noch nicht wissen konnte: Gottes gerechter Zorn wurde ausgegossen. Er landete auf den Schultern des Lammes, dass der Welt Sünden trägt. Und das geschah nur wenige Monate nachdem Johannes selbst einen Märtyrertod starb.
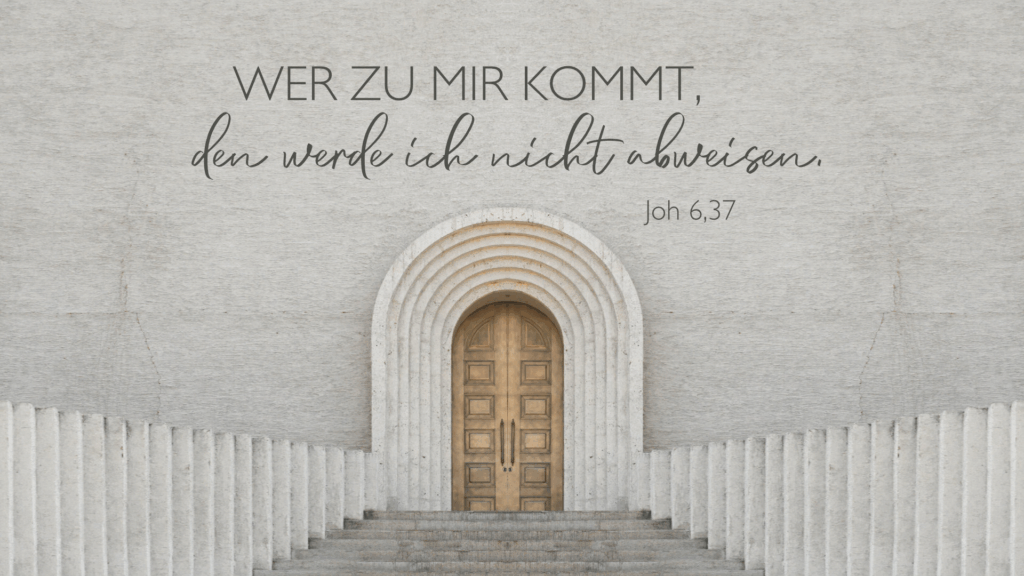
[1] Die wiederholten Bitten nach Zeichen deuten in eine ähnliche Richtung (Mt 16,1-4 Mk 8,11-12, Lk 12,54-46, aber auch Joh 2,18; 4,48; 6,26-34). Dies zeigt, dass die Erwartungen an den Messias häufig weniger von den Vorhersagen der Schrift als von volkstümlichen Erwartungen geprägt waren.
[2] Dass sich in Ephesus viele Jahre nach dem Wirken des Täufers in einem völlig anderen Kulturkreis Einflüsse seines Wirkens finden, zeigt die Reichweite und den Einfluss des Täufers.
[3] Im Kontext der Gerichtverkündigung wird auch deutlich, was mit der „Taufe mit Feuer“ gemeint ist: Ein Eintauchen in das Gericht Gottes. Wenn der Täufer mit dem Blick auf die Größere Taufe des Messias Hes 36,25 im Blick hat, ist der Reinigungsaspekt der Taufe noch stärker betont (vgl. auch: James M. Hamilton Jr. God’s Glory in Salvation through Judgment. A Biblical Theology. Wheaton: Crossway, 2010, 367.
[4] J. A. Motyer. “Judgment“. In: Desmond Alexander/Brian S. Rosner (Hg.). New Dictionary of Biblical Theology. Downers Grove: InterVarsity Press, 2000, 612.
[5] J. A. Motyer. “Judgment“, 612.
[6] Zitiert in John Stott. Das Kreuz. Marburg: Verlag der Francke Buchhandlung, 2019, 215.
[7] Stott, Das Kreuz: 220



Schreibe einen Kommentar